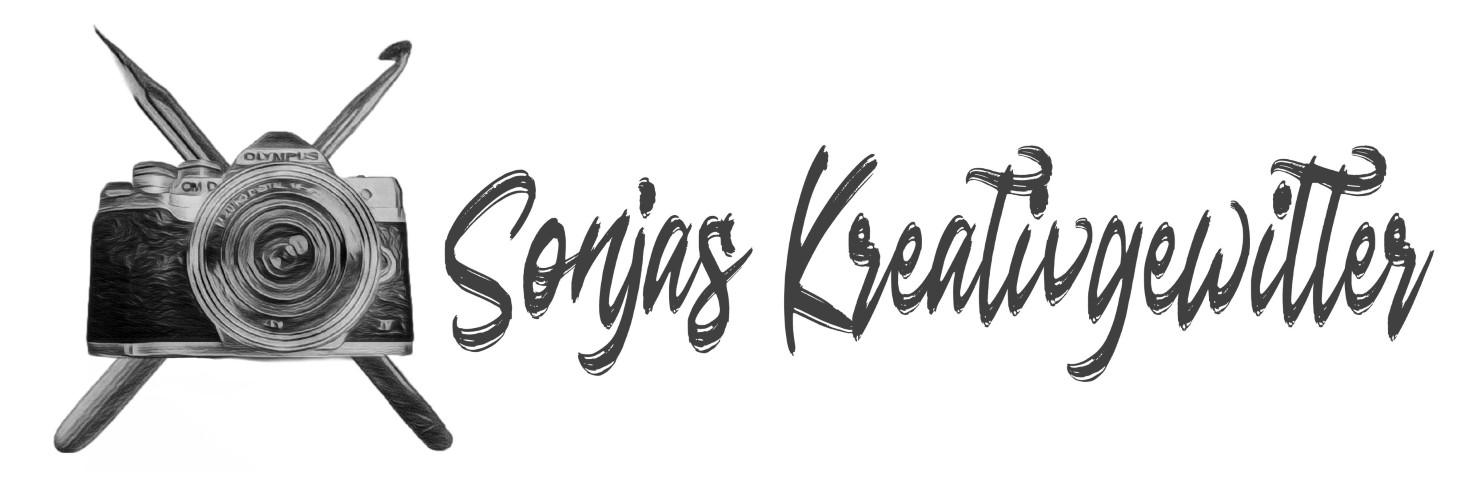Fotografie ist irgendwie magisch, oder? Du drückst den Auslöser und hälts einen Moment fest, der nie wieder genauso passiert. Egal ob du mit dem Smartphone, einer alten Analogkamera oder einer modernen digitalen Spiegelreflex- oder Systemkamera unterwegs bist, hinter jedem guten Foto steckt mehr als Zufall. Es geht um Licht und Schatten, Perspektive und Technik und natürlich die Emotionen, die du einfangen möchtest.
Damit du dich in diesem spannenden Mix aus Kunst und Technik besser zurechtfindest, habe ich dir hier ein umfangreiches Glossar zusammengestellt, welches dir wichtige Begriffe aus der Welt der Fotografie erklärt – von A wie Abblenden bis Z wie Zoomobjektiv.
Abblenden
Abblenden bedeutet, die Blendenöffnung deiner Kamera kleiner zu machen – also die Blendenzahl zu erhöhen (z. B. von f/2.8 auf f/8).
Dadurch gelangt weniger Licht auf den Sensor, aber die Schärfentiefe nimmt zu: mehr vom Motiv erscheint scharf.
Das ist besonders praktisch bei Landschaftsaufnahmen, Architektur oder Gruppenbildern, wo du von vorn bis hinten Klarheit brauchst.
Achtung: Wenn du zu stark abblendest (ab f/16 oder kleiner), kann die sogenannte Beugungsunschärfe auftreten – das Bild wird leicht weicher.
💡 Tipp:
Für die meisten Objektive liegt die „Sweet Spot“-Blende zwischen f/5.6 und f/8 – dort erzielst du maximale Schärfe.
Available Light
Available Light bezeichnet das Fotografieren mit dem vorhandenen Licht – ohne zusätzliche Lichtquellen wie Blitz oder Softbox.
Das kann Sonnenlicht, Kerzenschein oder auch eine Straßenlaterne sein.
Die Kunst beim Available-Light-Fotografieren liegt darin, das vorhandene Licht zu verstehen und kreativ zu nutzen, statt gegen es anzukämpfen.
Oft erzeugt gerade das „unperfekte“ Licht – schräg, diffus oder schwach – besonders stimmungsvolle Aufnahmen.
💡 Praxis-Tipp:
Nutze hohe ISO-Werte (800–3200) und offene Blenden (f/1.8–f/2.8), um auch bei wenig Licht ohne Blitz fotografieren zu können.
Autofokus (AF)
Der Autofokus stellt automatisch auf das Motiv scharf. Moderne Kameras verwenden Phasen- oder Kontrastmessung, teils auch KI-basierte Motiverkennung.
Es gibt unterschiedliche Modi:
- AF-S (Einzelfokus): Schärfe wird einmal eingestellt – ideal für unbewegte Motive.
- AF-C (Nachführfokus): Die Kamera verfolgt bewegte Motive fortlaufend.
- AF-A (Automatik): Die Kamera entscheidet selbst, wann sie zwischen AF-S und AF-C wechselt.
💡 Praxis-Tipp:
Nutze AF-C bei Bewegung (Sport, Tiere, Kinder) und AF-S für ruhige Motive.
Und: Lerne, die Fokuspunkte manuell zu wählen – das gibt dir Kontrolle über deinen Bildausschnitt.
Bajonett (Objektivanschluss)
Das Bajonett ist die mechanische Verbindung zwischen Kamera und Objektiv.
Jede Marke nutzt ihr eigenes System (Canon RF, Nikon Z, Sony E usw.).
Achte beim Kauf darauf, dass Objektive kompatibel sind – sonst brauchst du Adapter, die Autofokus oder Bildstabilisator einschränken können.
💡 Praxis-Tipp:
Wenn du in ein Kamerasystem investierst, denke langfristig.
Die Objektive sind die wirkliche Investition – sie überleben oft mehrere Kameragenerationen.
Belichtungsdreieck
Das Belichtungsdreieck ist das Herzstück fotografischer Technik.
Es beschreibt das Zusammenspiel von Blende, Belichtungszeit und ISO – die drei Variablen, die gemeinsam die Helligkeit eines Fotos bestimmen.
- Blende: Menge des Lichts (und Schärfentiefe)
- Zeit: Dauer des Lichteinfalls (Bewegung einfrieren oder zeigen)
- ISO: Empfindlichkeit des Sensors (mehr Licht, aber auch mehr Rauschen)
💡 Praxis-Tipp:
Stell dir das Dreieck wie drei Schieberegler vor.
Wenn du z. B. die Blende öffnest (mehr Licht), kannst du ISO senken oder die Belichtungszeit verkürzen – Balance ist der Schlüssel.
Belichtungszeit (Verschlusszeit)
Die Belichtungszeit (auch Verschlusszeit) ist die Dauer, in der Licht auf den Sensor fällt
Kurze Zeiten (z. B. 1/2000 s) frieren Bewegung ein, lange (z. B. 1 s oder mehr) erzeugen Bewegungsspuren.
💡 Praxis-Tipp:
Wenn du aus der Hand fotografierst, halte dich an die Faustregel: Belichtungszeit = 1/Brennweite (z.B. 1/50s bei 50mm) ,sonst verwackelt’s. Bei längeren Belichtungszeiten solltest du ein Stativ benutzen.
Blende
Die Blende ist die Öffnung im Objektiv, durch die Licht auf den Kamerasensor fällt.
Sie funktioniert wie die Pupille deines Auges – weit geöffnet bei wenig Licht, eng geschlossen bei Helligkeit.
Die Blendenzahl (f-Wert) gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Öffnung an:
Kleine Zahlen wie f/1.8 bedeuten eine große Öffnung (viel Licht, geringe Schärfentiefe),
große Zahlen wie f/11 eine kleine Öffnung (weniger Licht, große Schärfentiefe).
Die Blende beeinflusst also nicht nur die Belichtung,
sondern auch die Gestaltung der Schärfeebene – also, was im Bild scharf und was unscharf erscheint.
💡Praxis-Tipp:
- Porträt: Offenblende (f/1.8 – f/2.8) für weiches Bokeh.
- Landschaft: Abblenden (f/8 – f/11) für durchgehende Schärfe.
- Kreativ: Spiele mit Blende und Fokuspunkt – so führst du den Blick des Betrachters.
Bokeh
Bokeh beschreibt die ästhetische Qualität der Unschärfe außerhalb der Schärfeebene.
Es ist kein Maß für „wie unscharf“ ein Bereich ist, sondern wie schön diese Unschärfe wirkt – weich, cremig, rund oder kantig.
Ein gutes Bokeh hebt dein Motiv hervor und sorgt für träumerische Tiefe.
💡 Praxis-Tipp:
Je offener die Blende (f/1.4–f/2.8) und je länger die Brennweite, desto stärker das Bokeh.
Achte auf Lichtquellen oder Reflexionen im Hintergrund – sie bringen das Bokeh richtig zum Leuchten.
Brennweite
Die Brennweite (in Millimetern angegeben) bestimmt, wie „nah“ oder „weit“ dein Motiv wirkt.
Kurze Brennweiten (z. B. 24 mm) zeigen weite Räume, lange (z. B. 200 mm) holen das Motiv nah heran.
Kreativer Effekt:
- Weitwinkel: mehr Tiefe, verzerrte Nähe, dynamisch
- Normalbrennweite (35–50 mm): natürlicher Eindruck
- Tele: ruhige, verdichtete Perspektive
💡 Praxis-Tipp:
Experimentiere mit der Distanz statt mit dem Zoom – geh näher ran oder tritt zurück. Dein Standpunkt verändert die Bildwirkung stärker als du denkst.
Crop-Faktor
Viele Kameras haben kleinere Sensoren als das klassische Vollformat.
Der Crop-Faktor gibt an, wie stark sich die Brennweite durch den kleineren Sensor verlängert.
Beispiel:
Ein 50 mm-Objektiv auf einer APS-C-Kamera (Crop-Faktor 1,5) entspricht einer Brennweite von 75 mm im Vollformat-Blickwinkel.
💡 Praxis-Tipp:
Wenn du Porträts mit APS-C fotografierst, sind 35 mm oder 50 mm eine gute Wahl – sie ergeben den klassischen 50–85 mm-Look.
Dynamikumfang
Der Dynamikumfang beschreibt, wie viele Helligkeitsstufen deine Kamera erfassen kann – vom tiefsten Schwarz bis zum hellsten Weiß.
Ein hoher Dynamikumfang bedeutet, dass du gleichzeitig Details in Schatten und Lichtern siehst.
💡 Praxis-Tipp:
Fotografiere im RAW-Format, um in der Nachbearbeitung mehr Zeichnung in hellen und dunklen Bereichen zu erhalten.
Drittelregel
Teile dein Bild mit zwei horizontalen und zwei vertikalen Linien in 9 gleiche Bereiche.
Die vier Schnittpunkte sind „starke Punkte“ – dort platzierte Motive wirken harmonisch und natürlich.
💡 Praxis-Tipp:
Aktiviere das Raster in deiner Kamera.
Platziere z. B. den Horizont im oberen oder unteren Drittel – nicht in der Mitte.
Kleine Verschiebungen können die gesamte Wirkung verändern.
EBV (Elektronische Bildverarbeitung)
EBV meint die digitale Nachbearbeitung deiner Fotos – also alles, was du am Computer machst: Farbkorrekturen, Zuschnitt, Retusche oder Kontrastanpassungen.
💡 Praxis-Tipp:
Bearbeite Bilder, um Stimmung zu betonen, nicht um Fehler zu verstecken.
Ein dezenter, natürlicher Look wirkt meist stärker als übertriebene Effekte.
Festbrennweite
Eine Festbrennweite hat – wie der Name sagt – eine feste Brennweite (z. B. 35 mm oder 50 mm).
Im Gegensatz zum Zoom zwingt sie dich, dich zu bewegen, den Standpunkt zu ändern und bewusster zu komponieren.
Vorteile:
- schärferes Bild
- meist lichtstärker (f/1.4, f/1.8)
- leichter und kompakter
💡 Praxis-Tipp:
Ein 50 mm-Objektiv ist der beste Lehrer. Es zeigt die Welt so, wie du sie mit dem Auge siehst – perfekt, um Sehen zu lernen.
Filter
Filter sind kleine Glas- oder Kunststoffscheiben vor dem Objektiv, die das Licht beeinflussen, bevor es auf den Sensor trifft.
Die wichtigsten Typen:
- UV-Filter: früher Schutz vor ultraviolettem Licht, heute meist als Linsenschutz verwendet.
- Polfilter: reduziert Spiegelungen, verstärkt Farben, macht Himmel satter.
- ND-Filter (Neutraldichte): verdunkelt das Bild, um längere Belichtungszeiten zu ermöglichen.
💡 Praxis-Tipp:
Ein Polfilter ist fast Pflicht für Landschaftsfotografie – er lässt Wasser klarer wirken und den Himmel dramatischer erscheinen.
Fokus-Peaking
Eine Funktion vieler moderner Kameras, besonders bei manuellem Fokus: scharfe Bereiche werden farbig hervorgehoben (z. B. rot oder gelb).
So kannst du präzise sehen, wo dein Fokus sitzt – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
💡 Praxis-Tipp:
Beim manuellen Fokussieren (z. B. in der Makrofotografie) ist Fokus-Peaking Gold wert.
Nutze eine hohe Vergrößerung im Sucher, um die Schärfe exakt zu setzen.
Gegenlicht
Gegenlicht entsteht, wenn die Hauptlichtquelle (z. B. Sonne, Lampe, Fenster) hinter deinem Motiv steht – also direkt in die Kamera scheint.
Viele Anfänger vermeiden es, weil es technisch schwierig ist: Der Vordergrund wird dunkel, die Lichter überstrahlen.
Aber kreativ genutzt ist Gegenlicht ein Traum! Es erzeugt leuchtende Konturen, Glanzlichter im Haar und eine weiche, atmosphärische Stimmung.
💡 Praxis-Tipp:
Aktiviere bei starkem Gegenlicht die Belichtungskorrektur (+EV) oder nutze Spotmessung auf dein Motiv.
Ein leicht angehobener Blitz oder Reflektor kann außerdem die Schatten aufhellen.
Goldene Stunde
Die Goldene Stunde ist die Zeit kurz nach Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang.
Das Licht ist dann weich, warm und golden – die Sonne steht tief, Schatten sind lang und schmeichelnd.
Fast jede Szene wirkt in diesem Licht magisch.
💡 Praxis-Tipp:
Plane deine Shootings nach der Sonne, nicht nach der Uhrzeit.
Apps wie „PhotoPills“ oder „Golden Hour One“ zeigen dir genau, wann das Licht ideal ist.
Graufilter (ND-Filter)
Ein Neutraldichtefilter – oft einfach Graufilter genannt – reduziert die Lichtmenge, die ins Objektiv fällt, ohne die Farben zu verändern.
So kannst du bei Tageslicht mit langen Belichtungszeiten arbeiten, etwa um Wasser weich oder Straßen menschenleer erscheinen zu lassen.
💡 Praxis-Tipp:
Ein ND8 reduziert Licht um 3 Blenden, ein ND1000 sogar um 10 Blenden – ideal für Langzeitbelichtungen bei Sonne.
HDR (High Dynamic Range)
HDR-Fotografie kombiniert mehrere unterschiedlich belichtete Aufnahmen zu einem Bild mit erweitertem Dynamikumfang.
So kannst du Details in hellen und dunklen Bereichen gleichzeitig sichtbar machen – besonders bei Sonnenuntergängen, Innenräumen oder Gegenlicht.
💡 Praxis-Tipp:
Verwende HDR sparsam und dezent.
Zu stark betonte HDR-Effekte wirken oft künstlich – besser ist ein natürlicher Look mit weichen Übergängen.
Histogramm
Das Histogramm zeigt die Helligkeitsverteilung eines Fotos.
Links stehen die Schatten, rechts die Lichter, in der Mitte die Mitteltöne.
Ein ausgeglichenes Histogramm bedeutet, dass weder etwas zu dunkel noch zu hell abgeschnitten ist.
💡 Praxis-Tipp:
Verlass dich nicht nur auf dein Kameradisplay – prüfe das Histogramm, vor allem bei Sonnenlicht.
Wenn die Kurve rechts „anschlägt“, ist dein Bild überbelichtet.
Hyperfokale Distanz
Ein Begriff aus der Landschaftsfotografie:
Fokussierst du auf die hyperfokale Distanz, ist alles von der halben Entfernung bis unendlich scharf.
Das ermöglicht maximale Schärfentiefe – perfekt für Landschaften und Architektur.
💡 Praxis-Tipp:
Es gibt Smartphone-Apps, die dir die hyperfokale Distanz für deine Kamera und Blende berechnen.
Als Faustregel: Bei 24 mm und f/8 liegt sie etwa bei 3 Metern.
ISO
ISO steht für die Lichtempfindlichkeit des Sensors.
Ein niedriger ISO (100–400) liefert saubere, detailreiche Bilder.
Ein hoher ISO (800–6400 +) hellt dunkle Szenen auf, erzeugt aber Bildrauschen.
💡 Praxis-Tipp:
„So niedrig wie möglich, so hoch wie nötig.“
Steigere ISO lieber moderat und stabilisiere deine Kamera, statt das Rauschen später herausrechnen zu müssen.
JPEG
JPEG ist das am weitesten verbreitete Bildformat.
Es komprimiert Fotos stark, um Speicherplatz zu sparen – das geht aber auf Kosten der Detailtiefe und Nachbearbeitungsfreiheit.
💡 Praxis-Tipp:
Fotografiere im RAW-Format, wenn du später bearbeiten willst, und nutze JPEG nur für schnelle Veröffentlichungen oder Social Media.
Kameramodus
Die meisten Kameras bieten verschiedene Automatik- und Halbautomatik-Modi:
- P (Programmautomatik): Kamera wählt Blende & Zeit, du steuerst ISO.
- A / Av (Zeitautomatik): du wählst Blende, Kamera Zeit.
- S / Tv (Blendenautomatik): du wählst Zeit, Kamera Blende.
- M (Manuell): volle Kontrolle über alle Werte.
💡 Praxis-Tipp:
Lerne, mit der Zeitautomatik (A/Av) umzugehen – sie ist ideal für die meisten Situationen und gibt dir kreative Freiheit über die Schärfentiefe.
Komposition
Komposition ist die bewusste Anordnung der Bildelemente.
Sie lenkt das Auge und bestimmt, wie harmonisch oder spannend ein Foto wirkt.
Typische Prinzipien sind Drittelregel, Linienführung, Symmetrie und Negativraum.
💡 Praxis-Tipp:
Frag dich bei jedem Bild: Worauf soll der Blick zuerst fallen?
Alles andere sollte diese Hauptaussage unterstützen, nicht stören.
Kontrast
Kontrast beschreibt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen oder zwischen Farben und Strukturen.
Hoher Kontrast = stark, dynamisch, lebendig.
Niedriger Kontrast = weich, ruhig, träumerisch.
💡 Praxis-Tipp:
Verwende Kontrast gezielt, um Stimmung zu erzeugen.
Ein Porträt im weichen Licht wirkt sensibel, eines im harten Licht stark und markant.
Landschaftsfotografie
Ein Klassiker der Fotografie, bei dem du mit Weite, Licht und Tiefe arbeitest.
Hier geht es weniger um spektakuläre Motive, sondern um Komposition, Stimmung und Zeitgefühl.
💡 Praxis-Tipp:
- Blende leicht schließen (f/8–f/11) für maximale Schärfe.
- Verwende Stativ und Fernauslöser.
- Fotografiere zur Goldenen oder Blauen Stunde – Licht ist alles.
Lichtformer
Lichtformer verändern, lenken oder streuen Lichtquellen.
Dazu gehören Softboxen, Schirme, Reflektoren oder Diffusoren.
Sie helfen dir, hartes Licht weicher zu machen oder Schatten gezielt zu steuern.
💡 Praxis-Tipp:
Auch ein einfaches weißes Bettlaken oder ein Stück Styropor kann ein hervorragender Lichtformer sein.
Linienführung
Linien (real oder optisch) führen das Auge durch das Bild – Straßen, Zäune, Schatten, Flüsse.
Sie können Dynamik, Tiefe und Richtung erzeugen.
💡 Praxis-Tipp:
Achte auf führende Linien, die in dein Motiv hineinleiten.
Diagonalen wirken spannender als waagerechte Linien.
Low-Key
Low-Key bezeichnet einen Stil mit überwiegend dunklen Tonwerten und gezieltem Licht.
Die Schatten dominieren, das Licht betont nur bestimmte Details – geheimnisvoll, dramatisch, emotional.
💡 Praxis-Tipp:
Nutze ein einziges, gerichtetes Licht (z. B. Fenster oder Spot), um Gesichter oder Konturen hervorzuheben.
Low-Key funktioniert besonders gut in Schwarzweiß.
Makrofotografie
Makrofotografie bedeutet, sehr kleine Motive stark vergrößert abzubilden – zum Beispiel Insekten, Blüten oder Strukturen.
Im echten Maßstab 1:1 ist das Objekt auf dem Sensor genauso groß wie in der Realität.
Makros erfordern Geduld und Präzision: Schon kleinste Bewegungen verändern die Schärfeebene.
💡 Praxis-Tipp:
- Verwende Stativ oder Makroschiene.
- Blende leicht schließen (f/8–f/11) für mehr Schärfentiefe.
- Bei Wind oder Handaufnahmen: kurze Belichtungszeit oder Blitzlicht nutzen.
Manueller Modus (M)
Im manuellen Modus bestimmst du Blende, Belichtungszeit und ISO selbst.
Das gibt dir maximale Kontrolle über die Belichtung – aber auch Verantwortung.
Am Anfang mag das komplex wirken, doch wenn du verstanden hast, wie sich die drei Werte gegenseitig beeinflussen, wird es befreiend.
💡 Praxis-Tipp:
Übe an ruhigen Motiven (z. B. Stillleben) und kontrolliere das Histogramm.
Mit etwas Routine wirst du Licht „lesen“ können, ohne auf die Automatik zu schauen.
Mittelgrau
Mittelgrau (18 % Grau) ist die neutrale Helligkeit, auf die Kameras ihre Belichtungsmessung ausrichten.
Das heißt: Deine Kamera „denkt“, jede Szene sei im Durchschnitt mittelgrau – was zu Fehlbelichtungen führen kann, wenn du sehr helle oder dunkle Motive fotografierst.
💡 Praxis-Tipp:
Bei Schnee oder Sand: Belichtung +1 EV.
Bei dunklen Szenen: Belichtung –1 EV.
So kompensierst du die Tendenz der Kamera, alles grau zu machen.
Monochrom
Monochrome Fotografie beschränkt sich auf eine einzige Farbfamilie – meist Schwarzweiß, manchmal aber auch Sepia oder Blautöne.
Ohne Farbe treten Formen, Kontraste und Lichtstimmungen stärker hervor.
💡 Praxis-Tipp:
Denke beim Fotografieren in Helligkeit und Struktur.
Schwarzweiß lebt von starken Kontrasten – achte auf klare Hell-Dunkel-Trennungen.
ND-Filter (Neutraldichtefilter)
Ein ND-Filter funktioniert wie eine Sonnenbrille fürs Objektiv: Er lässt weniger Licht durch, ohne die Farben zu verändern.
So kannst du auch bei Tageslicht mit längeren Belichtungszeiten arbeiten – ideal für fließendes Wasser, Wolken oder Menschenmengen, die verschwimmen sollen.
💡 Praxis-Tipp:
Ein ND64- oder ND1000-Filter ist perfekt für Langzeitbelichtungen bei Sonne.
Benutze ein Stativ und stell den Fokus ein, bevor du den Filter aufschraubst.
Objektiv
Das Objektiv ist das „Auge“ deiner Kamera.
Seine Qualität, Brennweite und Lichtstärke bestimmen, wie dein Bild aussieht – oft stärker als der Kamerasensor selbst.
Jedes Objektiv hat seinen Charakter:
- Weitwinkel → offen, dynamisch
- Tele → ruhig, komprimiert
- Festbrennweite → lichtstark, detailreich
💡 Praxis-Tipp:
Investiere langfristig in gute Objektive – sie sind das Herzstück deiner Ausrüstung und beeinflussen Stil und Bildsprache stärker als die Kamera.
Panoramafotografie
Hierbei kombinierst du mehrere überlappende Aufnahmen zu einem weiten Gesamtbild.
So entsteht ein großes Panorama mit beeindruckender Weite.
💡 Praxis-Tipp:
- Kamera waagerecht halten, am besten auf Stativ.
- 30 % Überlappung zwischen den Bildern.
- Identische Belichtung für alle Aufnahmen, sonst entstehen Helligkeitssprünge.
Perspektive
Die Perspektive beschreibt den Blickwinkel, aus dem du fotografierst.
Dein Standpunkt bestimmt, wie Linien, Größen und Tiefen wirken – und ob dein Foto ruhig oder dynamisch erscheint.
💡 Praxis-Tipp:
Ändere bewusst die Perspektive:
Geh in die Hocke, steig auf etwas, fotografiere schräg.
Eine neue Perspektive kann aus einem alltäglichen Motiv etwas Besonderes machen.
Pixel
Pixel sind die kleinsten Bildelemente einer digitalen Aufnahme.
Mehr Pixel bedeuten theoretisch mehr Detail – aber nur, wenn der Sensor und das Objektiv diese Auflösung auch liefern können.
💡 Praxis-Tipp:
Megapixel sind überbewertet.
Wichtiger ist Sensorgröße, Lichtqualität und Objektivschärfe.
Polarisationsfilter (Polfilter)
Ein Polfilter reduziert Reflexionen auf Glas, Wasser oder Metall und verstärkt Farben – besonders Himmel und Laub wirken satter.
Der Filter lässt nur Licht in einer bestimmten Schwingungsrichtung durch, daher musst du ihn durch Drehen justieren.
💡 Praxis-Tipp:
Dreh am Filter, während du durch den Sucher schaust, bis die Spiegelungen verschwinden oder der Himmel kräftiger wirkt.
Achtung: Bei Weitwinkelobjektiven kann der Effekt ungleichmäßig aussehen.
Porträtfotografie
Porträtfotografie ist die Kunst, Menschen in ihrem Ausdruck und Charakter einzufangen – nicht nur ihr Äußeres.
Licht, Blickrichtung, Hintergrund und Brennweite beeinflussen, wie dein Motiv wahrgenommen wird.
💡 Praxis-Tipp:
- 85 mm (Vollformat) oder 50 mm (APS-C) erzeugt natürliche Proportionen.
- Offene Blende (f/2 – f/2.8) für weiches Bokeh.
- Rede mit deinem Modell – Vertrauen ist wichtiger als Technik.
RAW
Das RAW-Format enthält alle Rohdaten des Sensors – ähnlich wie ein digitales Negativ.
Im Gegensatz zu JPEG kannst du Belichtung, Weißabgleich und Farben im Nachhinein ohne Qualitätsverlust anpassen.
💡 Praxis-Tipp:
Fotografiere in RAW, wenn du später nachbearbeiten willst.
Nur so nutzt du den vollen Dynamikumfang und behält Kontrolle über dein Licht.
Rauschen
Rauschen sind kleine, bunte oder graue Punkte im Bild, die bei hohen ISO-Werten oder schwachem Licht auftreten.
Digitale Kameras erzeugen Rauschen, wenn der Sensor das fehlende Licht elektronisch „auffüllt“.
💡 Praxis-Tipp:
Vermeide unnötig hohe ISO-Werte.
Wenn du Rauschen in Kauf nehmen musst, belichte lieber leicht über (aber ohne Ausbrennen) – das reduziert Rauschanteile deutlich.
Reflektor
Ein Reflektor ist eine einfache, aber mächtige Lichtquelle: Er wirft vorhandenes Licht zurück und hellt Schatten auf.
Er ist günstig, leicht und in Silber, Weiß oder Gold erhältlich.
💡 Praxis-Tipp:
Silber = starkes, kühles Licht.
Gold = warm, weich.
Weiß = neutral.
Nutze ihn, um Gesichter aufzuhellen oder Kontraste zu mildern – auch ein weißes T-Shirt oder ein Blatt Papier kann als Reflektor dienen.
Rote-Augen-Effekt
Entsteht, wenn das Blitzlicht direkt in die Pupillen reflektiert und das Blut in der Netzhaut rötlich zurückstrahlt.
Typisch bei eingebauten Blitzen und wenig Umgebungslicht.
💡 Praxis-Tipp:
Blitz leicht versetzen oder indirekt blitzen (z. B. an Decke oder Wand reflektieren).
Alternativ: Blitz aus, ISO erhöhen und mit natürlichem Licht arbeiten.
Schärfentiefe
Die Schärfentiefe beschreibt den Bereich im Foto, der scharf wirkt – vor und hinter deinem Fokuspunkt.
Sie hängt von drei Faktoren ab: Blende, Brennweite und Abstand zum Motiv.
- Große Blende (f/1.8) = geringe Schärfentiefe → weicher Hintergrund.
- Kleine Blende (f/11) = große Schärfentiefe → alles von vorn bis hinten scharf.
💡 Praxis-Tipp:
Für Porträts: geringe Schärfentiefe (f/2–f/3.5).
Für Landschaften: hohe Schärfentiefe (f/8–f/11).
Spiel damit – das ist eines der stärksten Stilmittel in der Fotografie.
Schwarzweißfotografie
Schwarzweiß reduziert Fotos auf Licht, Kontrast und Form.
Ohne Farbe wird das Auge gezwungen, sich auf Struktur und Stimmung zu konzentrieren – ideal für Porträts, Architektur oder Streetfotografie.
💡 Praxis-Tipp:
Fotografiere in RAW, auch wenn du Schwarzweiß willst.
So kannst du später entscheiden, wie du Kontraste und Tonwerte setzt.
Denke beim Fotografieren schon in Helligkeit statt in Farbe.
Selbstauslöser
Ein simpler, aber nützlicher Helfer: Der Selbstauslöser löst die Kamera mit einer Verzögerung (z. B. 2 oder 10 Sekunden) aus.
Ideal für Gruppenfotos, Selbstporträts oder Langzeitbelichtungen, bei denen du Verwacklungen vermeiden willst.
💡 Praxis-Tipp:
Bei Stativaufnahmen lieber Selbstauslöser oder Fernauslöser nutzen – schon der kleinste Druck auf den Auslöser kann dein Bild minimal verwackeln.
Sensor
Der Sensor ist das digitale Pendant zum Film – er wandelt Licht in elektrische Signale um.
Es gibt verschiedene Größen (Vollformat, APS-C, Micro Four Thirds), die Einfluss auf Bildqualität, Rauschen und Schärfentiefe haben.
💡 Praxis-Tipp:
Ein größerer Sensor bietet mehr Dynamikumfang und geringeres Rauschen, ist aber teurer.
Wichtiger als die Größe ist, wie du Licht nutzt.
Spiegelvorauslösung
Bei Spiegelreflexkameras klappt beim Auslösen ein Spiegel hoch – das kann minimale Vibrationen verursachen.
Mit der Spiegelvorauslösung wird der Spiegel vor der Aufnahme hochgeklappt, sodass das Bild völlig ruhig aufgenommen wird.
💡 Praxis-Tipp:
Ideal für Makros, Teleaufnahmen oder Langzeitbelichtungen.
Bei spiegellosen Kameras entfällt das Problem automatisch.
Spotmessung
Die Spotmessung misst die Belichtung nur in einem kleinen Bereich des Bildes – meist in der Mitte oder an einem gewählten Punkt.
So kannst du präzise auf das Motiv belichten, auch wenn der Hintergrund sehr hell oder dunkel ist.
💡 Praxis-Tipp:
Perfekt für Gegenlichtsituationen oder Porträts mit starkem Kontrast.
Messe auf das Gesicht, nicht auf den Himmel – sonst wird dein Motiv zu dunkel.
Stativ
Das Stativ ist der beste Freund der Geduldigen.
Es stabilisiert deine Kamera, ermöglicht lange Belichtungszeiten und präzise Bildgestaltung.
Ein gutes Stativ ist stabil, leicht und lässt sich schnell aufbauen.
💡 Praxis-Tipp:
Achte auf stabile Beine, Kugelkopf und Haken für Gegengewicht.
Zieh die Mittelsäule nur aus, wenn es wirklich nötig ist – das mindert Erschütterungen.
Streetfotografie
Streetfotografie fängt das Leben auf der Straße ein – spontan, ehrlich, manchmal unperfekt.
Es geht um den Moment, nicht um Inszenierung.
Die besten Streetfotos erzählen kleine Geschichten, oft mit Humor, Spannung oder Menschlichkeit.
💡 Praxis-Tipp:
- Nutze leise, unauffällige Kameras.
- 35 mm oder 50 mm Brennweite – nah am Geschehen.
- Bleib respektvoll, aber mutig – der Moment zählt mehr als die Perfektion.
Synchronzeit
Die Synchronzeit (X-Sync) ist die kürzeste Belichtungszeit, bei der der Blitz mit dem Verschluss der Kamera synchron auslösen kann.
Liegt meist zwischen 1/125 s und 1/250 s.
Kürzere Zeiten führen zu halb belichteten Bildern, weil der Verschlussvorhang noch nicht vollständig geöffnet ist.
💡 Praxis-Tipp:
Für Outdoor-Blitzaufnahmen nutze den High-Speed-Sync-Modus (HSS), falls deine Kamera ihn unterstützt – damit kannst du auch mit 1/1000 s blitzen.
Teleobjektiv
Teleobjektive (z. B. 85 mm, 200 mm, 400 mm) holen entfernte Motive nah heran.
Sie komprimieren Perspektive, isolieren Motive und erzeugen sanfte Hintergrundunschärfe.
💡 Praxis-Tipp:
Ideal für Porträts, Tiere oder Sport.
Achte auf Verwacklung – nutze kurze Belichtungszeiten oder Stativ.
Und: Je länger das Tele, desto wichtiger die gute Haltung (Ellbogen an den Körper!).
Tiefenschärfe
Oft synonym mit Schärfentiefe verwendet – technisch bezeichnet sie die Schärfeausdehnung im Raum.
Sie ist das Werkzeug, um Motive hervorzuheben oder Hintergrund und Vordergrund miteinander zu verbinden.
💡 Praxis-Tipp:
Experimentiere: Fokussiere auf verschiedene Entfernungen bei gleicher Blende – du wirst sofort sehen, wie Tiefenschärfe deinen Bildaufbau verändert.
Time-Lapse (Zeitraffer)
Beim Zeitraffer machst du über längere Zeit viele Einzelbilder, die später zu einem Video zusammengesetzt werden.
So werden langsame Bewegungen sichtbar – Wolken, Sterne, Stadtverkehr.
💡 Praxis-Tipp:
- Intervallauslöser verwenden.
- Kamera auf manuelle Belichtung stellen (sonst flackert’s).
- Akku und Speicherkarte prüfen – Zeitraffer dauert!
Tonwertumfang
Der Tonwertumfang beschreibt, wie fein dein Bild Helligkeiten von Schwarz bis Weiß darstellt.
Ein großer Tonwertumfang wirkt plastisch und detailreich.
Du kannst ihn in der Nachbearbeitung mit Gradationskurven steuern.
💡 Praxis-Tipp:
Zieh die Tiefen leicht nach unten und die Lichter sanft nach oben – das erzeugt Kontrast, ohne Details zu verlieren.
Unterbelichtung
Wenn zu wenig Licht auf den Sensor fällt, wird das Bild zu dunkel.
Unterbelichtete Fotos verlieren Zeichnung in den Schatten und wirken flach.
💡 Praxis-Tipp:
Lieber leicht überbelichten (ca. +0.3 EV), wenn du in RAW fotografierst – das gibt mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung.
Vignettierung
Eine Vignettierung ist die Abdunkelung der Bildecken im Vergleich zur Bildmitte.
Sie entsteht durch Objektivkonstruktion, kann aber auch bewusst als Stilmittel eingesetzt werden, um den Blick zu lenken.
💡 Praxis-Tipp:
Leichte Vignettierung lenkt das Auge zum Motiv.
Übertreib es nicht – subtile Abdunklung wirkt oft am besten.
Weißabgleich
Der Weißabgleich sorgt dafür, dass Weiß auf dem Foto auch wirklich weiß erscheint – egal, ob du bei Sonnenlicht, Neonlicht oder Kerzenschein fotografierst.
Automatik funktioniert meist gut, aber manuell kannst du bewusster steuern, wie warm oder kühl dein Bild wirkt.
💡 Praxis-Tipp:
Für warme Stimmung → „Bewölkt“ oder „Schatten“.
Für kühles Licht → „Kunstlicht“.
Oder fotografiere in RAW und korrigiere später ganz frei.
Weitwinkel
Weitwinkelobjektive (z. B. 16–35 mm) zeigen mehr vom Raum, betonen Tiefe und führen Linien zusammen.
Sie sind großartig für Architektur, Landschaft und Reportage – aber sie verzerren auch Perspektiven, wenn du zu nah dran bist.
💡 Praxis-Tipp:
Geh nah ran, um Dynamik zu erzeugen, oder bleib auf Distanz für ruhige, natürliche Weite.
Achte darauf, den Horizont gerade zu halten.
Weißes Rauschen
In der Fotografie bezeichnet es das gleichmäßige, feine Rauschen bei hohen ISO-Werten oder dunklen Szenen.
Nicht jedes Rauschen ist schlecht – ein wenig davon kann Bildern sogar organische Struktur geben.
💡 Praxis-Tipp:
In Schwarzweißfotos darf leichtes Rauschen bleiben – es verstärkt oft den analogen Look.
Zoomobjektiv
Ein Zoomobjektiv deckt mehrere Brennweiten ab (z. B. 24–70 mm oder 70–200 mm).
Es ist vielseitig, spart Zeit und Ausrüstung, aber meist weniger lichtstark als eine Festbrennweite.
💡 Praxis-Tipp:
Nutze Zoom nicht als „Faulheits-Funktion“ – bewege dich trotzdem.
Wenn du den Standpunkt änderst, verändert sich die Perspektive – das kann kein Zoom ersetzen.
Zubehör
Alles, was das Fotografieren einfacher, sicherer oder kreativer macht: Stativ, Filter, Fernauslöser, Ersatzakkus, Taschen, Speicherkarten, Reinigungsset.
Oft sind es diese kleinen Dinge, die zwischen Frust und Freude entscheiden.
💡 Praxis-Tipp:
Pack leicht, aber klug.
Ein Ersatzakku und ein Mikrofasertuch retten dir oft mehr Aufnahmen als ein neues Objektiv.
Zeitraffer (Time-Lapse)
(siehe „Time-Lapse“)
Zeigt Veränderungen über längere Zeit komprimiert – eine wunderbare Möglichkeit, Bewegung sichtbar zu machen.
Egal ob ziehende Wolken, Sternenhimmel oder Stadtverkehr – Zeitraffer verwandelt Minuten in Sekunden und lässt uns Zeit neu erleben.